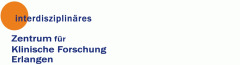Infektionsforschung und Immunologie
J90: Darja Andreev, Medizinische Klinik 3
Der Einfluss von Eosinophilen auf den Knochenabbau
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.01.2022 – 30.06.2024
Ein gesunder Knochen beruht auf dem Gleichgewicht zwischen Osteoblasten und Osteoklasten. Dabei führt eine erhöhte Osteoklastenaktivität häufig zu Knochenschwund. Das Immunsystem hat einen starken Einfluss auf Osteoklasten und begünstigt meist ihre Entwicklung. Wir konnten zeigen, dass eosinophile Granulozyten sich negativ auf die Entstehung und Funktion von Osteoklasten auswirken. Daher ist es wichtig, die molekularen Mechanismen, die dieser Beobachtung zugrunde liegen, näher zu untersuchen.
 |
| Projektleiterin Dr. Darja Andreev Telefon: 09131 85-29291 E-Mail: darja.andreev@uk-erlangen.de |
J91: Jean-Philippe Auger, Medizinische Klinik 3
Makrophagen-Reprogrammierung durch Glukokortikoide
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.01.2022 – 30.06.2024
Glukokortikoide gehören zu den wichtigsten Entzündungshemmern. Sie fördern das Abklingen der Entzündung durch funktionelle Reprogrammierung von Makrophagen. Dabei wird die Produktion von Itaconsäure angeregt, welche als Immunmetabolit und Teil der immunmetabolischen Neuausrichtung bereits bekannt ist. Die Rolle sowie der Wirkmechanismus von glukokortikoid-induzierter Itaconsäure in Makrophagen sind weiterhin unbekannt, jedoch wesentlich für die Optimierung der Behandlung mit Glukokortikoiden.
 |
| Projektleiter Dr. Jean-Philippe Auger Telefon: 09131 85-39313 E-Mail: Philippe.Auger@extern.uk-erlangen.de |
J104: Tanja Müller, Medizinische Klinik 1
Stat5 bei chronischer Kolitis
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.11.2023 – 30.04.2026
T-Zellen spielen eine wichtige Rolle bei CED, aber wie Stat5 in CD4+ T-Zellen Kolitis beeinflusst, ist unklar. Vorläufige Daten zeigen die spontane Entwicklung von chronischer Kolitis in konditionalen Stat5 KO-Mäusen und erniedrigte Stat5-Expression bei CED. Meine Hypothese ist daher, dass Stat5 in CD4+ T-Zellen Kolitis entgegenwirkt. In diesem Projekt werde ich die Mechanismen und Effekte CD4-spezifischer Stat5-Aktivität untersuchen und hoffe, dabei neue Therapieansätze zu identifizieren.
Dr. Tanja Müller
Medizinische Klinik 1
- E-Mail: tanja.mueller@uk-erlangen.de
J105: Katharina Pracht, Molekular-Immunologische Abteilung
GLUT1- Metabolismus und Antikörperantwort
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.10.2023 – 31.03.2026
Die Sezernierung korrekt glykosylierter protektiver Antikörper durch langlebige Plasmazellen ist essenziell für unseren Immunschutz. Um zu Überleben und Antikörper zu produzieren, brauchen Sie einen angepassten Metabolismus. Unser Ziel ist es herauszufinden, ob der Glukosetransporter GLUT1 eine Rolle im Metabolismus langlebiger Plasmazellen und der Funktionalität ihrer Antikörper hat. Hierfür werden wir ein GLUT1-defizientes Mausmodell und Patienten mit GLUT1-Defizienz Syndrom untersuchen.
Dr. Katharina Pracht
Molekular-Immunologische Abteilung
- E-Mail: katharina.pracht@uk-erlangen.de
J106: Maria Gabriella Raimondo, Medizinische Klinik 3
Immunzellen der Haut bei Psoriasis-Arthritis
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.09.2023 – 28.02.2026
Bis heute ist noch unklar, warum bei einigen Patienten mit Psoriasis der Autoimmunprozess auf die Haut beschränkt ist, während sie sich bei anderen auf die Gelenke erstreckt. Wir werden Psoriasis und Psoriasis-Arthritis Modelle verwenden, um die Gelenkbeteiligung als Folge einer Dermatitis zu forschen. Das Verständnis der zugrundeliegenden „Hautgelenksachse“Mechanismen ist entscheidend für die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze zur Vermeidung der Entzündungsausbreitung auf die Gelenke.
Dr. Maria Gabriella Raimondo
Medizinische Klinik 3
J107: Simon Rauber, Medizinische Klinik 3
PU.1 in Osteoblasten und Osteoproliferation
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.01.2024 – 31.08.2026
PU.1 reguliert die Matrixproduktion fibrotischer Fibroblasten. Kürzlich konnten wir PU.1 auch in matrixproduzierenden Osteoblasten nachweisen. Nun wollen wir das PU.1-Netzwerk in Biopsien von Patienten mit osteoproliferativer Arthritis mittels bildgebender Massenzytometrie erfassen, die PU.1-gesteuerte Transkription humaner Osteoblastenkulturen mittels ATTAC/CHIP/RNA-Seq analysieren und einen neuen Osteoblasten-spezifischen PU.1-Inhibitor in experimenteller osteoproliferativer Arthritis testen.
Dr. Simon Rauber
Medizinische Klinik 3
- E-Mail: simon.rauber@uk-erlangen.de
J108: Alexander Schnell, Kinder- und Jugendklinik
Funktion des CFTR-Kanals in Immunzellen
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: 01.01.2024 – 30.06.2026
Ziel dieses Projekts ist die Identifizierung der Expression des CFTR-Komplexes und seine funktionelle Charakterisierung in Immunzellen bei zystischer Fibrose (CF). Darüber hinaus werden die Auswirkungen einer CFTR-modulierenden Therapie mit Elexacaftor – Tezacaftor – Ivacaftor (ETI) auf die Funktion von Immunzellen in einer CFTR-Knock-out-Zelllinie und einem CF-Schweinemodell sowie in primären, von Patienten stammenden Zellen untersucht.
J110: Oana-Maria Thoma, Medizinische Klinik 1
Verkürzung der epithelialen Telomere in UC
Schwerpunkt: Infektionsforschung und Immunologie
Laufzeit: Projekt hat noch nicht begonnen
Verschiedene Faktoren führen zur Entstehung von Colitis ulcerosa (UC). Die Verkürzung der Telomere wird häufig in Darmepithelzellen (IECs) von Patienten mit UC beobachtet. Dennoch ist die funktionelle Rolle der Telomerlänge in IECs nur unzureichend bekannt. In diesem Projekt soll untersucht werden, wie die Telomerlänge an der Regulation pro-inflammatorischer Signalwege beteiligt ist und die Integrität der Barriere bei Patienten mit UC beeinflusst.
Dr. Oana-Maria Thoma
Medizinische Klinik 1
- E-Mail: oana-maria.thoma@uk-erlangen.de